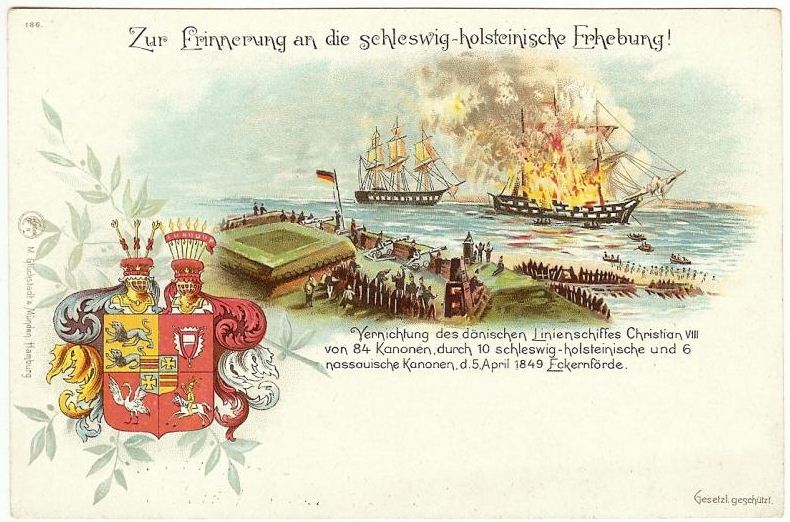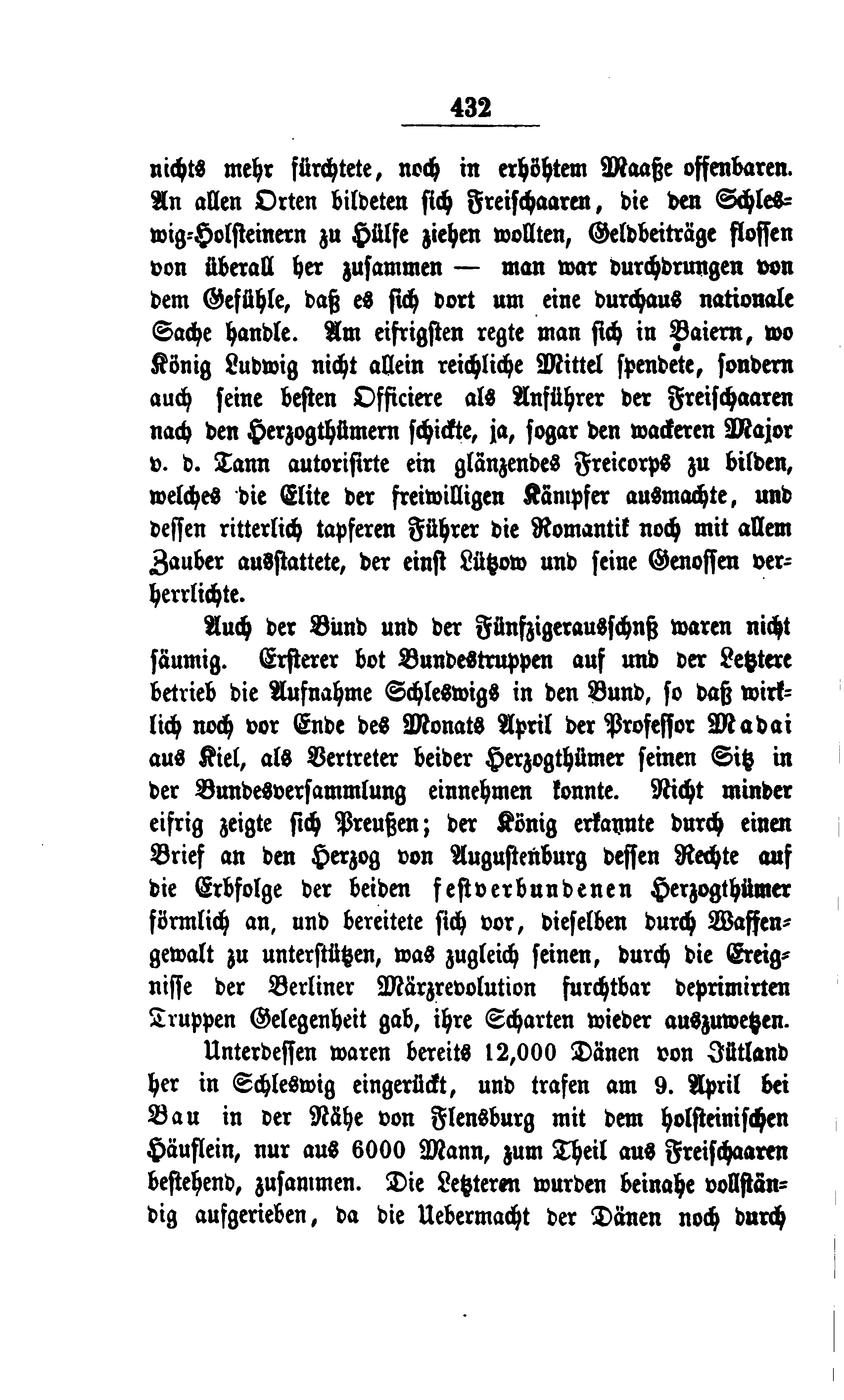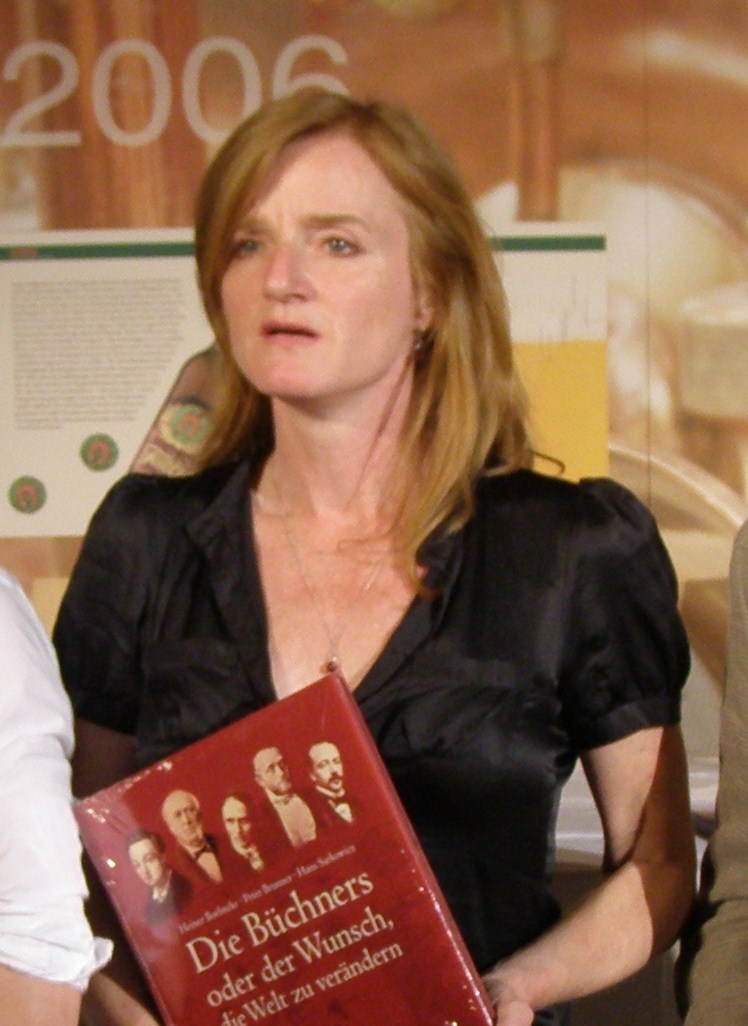Kürzlich habe ich angekündigt, weitere Recherchen zu Martha Frohwein-Büchner, der Großkusine unserer Büchners, anzustellen.

Das Ehepaar Frohwein-Büchner mit den beiden Söhnen Friedrich und Ernst-Armin 1918
Marthas Vater Friedrich Büchner (1826 – 1909) ist der erwähnte Autor von Coligny, er lebte von 1858 bis 1869 als Mitprediger in Zwingenberg. Martha wurde als viertes und letztes Kind von seiner Frau Marie Hirsch, geb. 1833 in Bingen, in Horrweiler geboren, wo er 1869 Pfarrer war.
Im Deutschen Literaturlexikon (Deutsches Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert. Band X. Hg. v. Konrad Feilchenfeldt. Zürich und München: K. G. Saur 2007) ist sie wie folgt verzeichnet:
Frohwein-Büchner, Martha (geb. Büchner, verh., Frohwein), * 24. 4. 1872 Horrweiler/Rheinhessen, + 25. 4. 1935 Ebsdorf bei Marburg/L; enstammte d. hess. Dichterfamilie Büchner u. lebte ab 1897 in Ebsdorf, verh. m. e. Arzt. Mundartdg., Erzählung.
Schriften: Hesse-Späss, I Heimatgruß an unsere lieben Feldgrauen, II Vom Fritzche un annere neue Hessespäss, 1915/16 (zahlr. Aufl. u. Ausg: 1920 erhebl. Verm. Gesamt-Ausg.; 8., verm. Aufl. u. d. T.: Gereimte Hesse-Späss, 1927); Nebelreich und Rosenland. Bunte Seidenfäden der Märchenmuhme M. F.-W., 1920; Das Mäuschen und anderes Gereimtes und Ungereimtes. o. J. (1927); Die uhleidliche Ellemutter. E hessisch Stickche, o. J. (1930).
Literatur: B. Sowinski, Lex. dt.sprachiger Mundartautoren, 1997
Die meisten dieser Texte sind über die bekannten antiquarischen Anbieter leicht und günstig zu bekommen; aus Nebelreich und Rosenland stelle ich hier einen Text online. Mit dem Autor der Sprachecke des DARMSTÄDTER ECHO, Heinrich Tischner, habe ich über diesen Text korrespondiert vielleicht ist dies die erste Erwähnung der rosaroten Brille, die wir so selbstverständlich als Metapher für einen schönend-unkritischen Blick verwenden.
Er schreibt:
„Zuerst hat mich ja die altertümelnde Redeweise mit den vielen „-leins“ gestört, die alles verniedlicht und putzig aussehen lässt. Und die völlig unrealistische Pracht des Palastes mit elfenbeinernen Säulen. Und die längst ausgestorbene Gattung der Muhme ‚Tante, Schwester der Mutter‘. Ob die kindlichen Leser diese Sprache verstanden haben?
Dann aber hat mich die Geschichte fasziniert. Das ist ja eigentlich kein Märchen, das in verfremdeter Form Begebenheiten aus dem wirklichen Leben erzählt, sondern eine Allegorie, die abstrakte Zusammenhänge verdeutlicht: die Phantasie als Mädchen mit einer rosenroten Brille, die verschiedenen Menschen, denen sie begegnet: Der erdverbundene Bauer, der dafür keinen Sinn hat der Schulmeister, der nur bedauern kann, dass er dem Kind keinen Respekt beibringen durfte der hochnäsige Junker mit seinem affektierten Gehabe und schließlich die drei Künstler, die ganz begeistert sind.
So ist es ja immer gewesen und auch heute noch: Es gibt Leute, die können Phantasie anderer verstehen andere sind so „nüchtern“, dass sie nichts erkennen können. Nur die Lehrer gehen heute anders mit diesem Thema um. Mindestens im Prinzip versuchen sie zu begreifen, dass phantasievolle Kinder keine Spinner sind.“
In Ebsdorfergrund, einem Dorf in der Nähe von Marburg, hat der Arzt Ulrich Freitag, der 1991 das dortige Doktorhaus und die Arztpraxis übernahm, 2004 im Selbstverlag eine kleine Schrift unter dem Titel 100 Jahre Doktorhaus Ebsdorf 1904 2004 veröffentlicht, die mir freundlicherweise der dortige Ortsvorsteher Heinrich Kutsch zur Verfügung stellte. Daher stammt auch das oben stehende Foto. Ulrich Freitag schreibt über Martha Büchner:
Eine außergewöhnliche Frau
Martha Frohwein-Büchner (geboren am 24. April 1872, gestorben am 25. April 1935) wirkte fast vier Jahrzehnte als Ehefrau des ersten Ebsdorfer Arztes, Dr. med. Carl Frohwein, im Dorf. In dieser Zeit widmete Martha Frohwein-Büchner sich intensiv der Brauchtumspflege. So zeichnete sie für regelmäßige Theater- und Volkstanzdarbietungen in Ebsdorf verantwortlich und war bei zahlreichen festlichen Veranstaltungen mit mundartlichen Gedichtvorträgen und Spinnstubendarstellungen in der Umgebung zu Gast. Noch heute steht in vielen Ebsdorfer Bücherregalen eine in der Elwert´schen Verlagsanstalterschienene Ausgabe der Hesse-Späߓ Über dieses kulturelle Engagement hinaus wurde ihr eine vorbildliche liberale Einstellung nachgesagt. Beispielhaft hierfür … ist auch der Kontakt, den sie über Jahre zu der in den Sommermonaten in Ebsdorf lagernden Sinti- und Romasippe aufrechterhielt. Martha Frohwein-Büchners Engagement und Gesinnung müssen wohl auch über die Dorfgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt haben, immerhin wurde ihr die Kandidatur zum Hessischen Landtag auf der Liste der Stresemann´schen Liberalen angetragen, deren Parteibuch sie auch besaß. Mit Rücksicht auf den Familienfrieden lehnte sie jedoch dankend ab. Carl Frohwein übrigens war eingeschriebenes Mitglied der Hugenberg´schen Deutschnationalen Volkspartei.
Die Einsicht, dass die Erinnerung an eine solche außergewöhnliche Frau nicht einschlafen dürfe, führte im Jahr 2001 auf Initiative des Verfassers zur Umbenennung der Grünfläche zwischen Bortshäuser Straße und Waldweg in Frohwein-Büchner-Platz.
Der ältere Sohn Friedrich wurde Jurist und war zuletzt Landgerichtsrat in Marburg, der jüngere Sohn Ernst-Armin wurde Arzt und übernahm zunächst 1936 die Praxis des Vaters. Bald darauf verließ er Ebsdorf nach Dresden, 1938 wurde das Ebsdorfer Haus an die Nachfolgerin Augusta Weber geb. Löber übergeben.
Marthas Bruder Alexander, (*1868 in Zwingenberg, + 1935 in Gießen) war auch Arzt geworden; er lebte fast nebenan im Schottener Doktorhaus, das er 1902 1904 nach den Plänen des Ebsdorfer Hauses errichten ließ.