Ich hab schon einmal gesagt, dass mich die vielen Darmstadt-Krimis eigentlich anöden und ich nicht verstehen kann, warum man scheinbar nur dann einen Roman über Darmstadt veröffentlichen kann, wenn man gleich am Anfang irgendwen abmurkst. Jetzt ist aber mit Scharfes Glas von Werner Münchow ein Darmstadt-Krimi erschienen, der zumindest auf den ersten Blick besser und interessanter erscheint. Das Echo schreibt hier darüber.
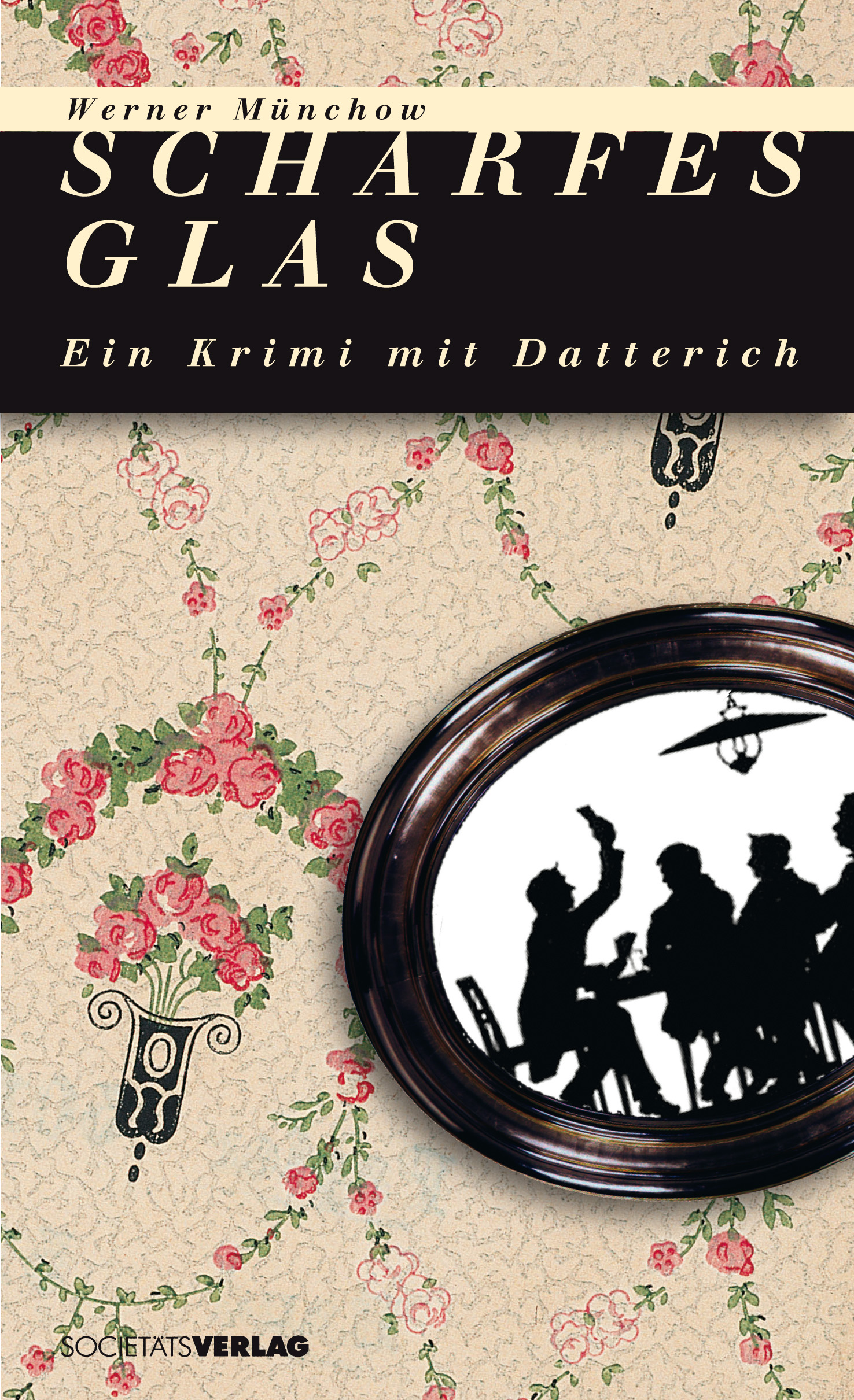
So macht sich am 7.12. Jörg Heléne in seinem Blog Gedanken und fragt am Ende: falls es irgendwer kauft bzw. gelesen hat, kann er/sie ja mal bescheid geben.
Nach diesem nachdrücklichen Hinweis blieb mir ja gar nichts anderes mehr übrig, und während der Feiertage hab ich ´s dann gelesen. Ich bin kein besonders kenntnisreicher Krimileser, auch die gelobten historischen Kriminalromane von Marek Krajewski aus dem Breslau der zwanziger und dreißiger Jahre habe ich (noch) nicht gelesen. Krajewski, dessen Authentizität immer wieder gelobt wird, schreibt über eine Zeit, aus der noch Augenzeugen leben und vor zwanzig Jahren konnte der 1966 in Wrocław geborene Autor sicher so viel von der Geschichte seiner Heimatstadt erfahren wie beispielsweise der Autor dieser Zeilen von seiner 1922 geborenen Mutter über das Darmstadt der dreißiger und vierziger Jahre. Münchow schreibt über Darmstadt 1833 – trotzdem war das meine erste Assoziation und zugleich Befürchtung: 1833 ist halt ein bisschen länger her…
Als wir in Pfungstadt begannen, Eine Stadt schreibt ein Buch auf die Beine zu stellen, aus dem dann ja unser Krimi Kirschen rot Spargel tot entstand, hieß der erste Hinweis im workshop, den uns Heiner Boehncke als Coach der Aktion gab: versucht Euch nicht an historischen Stoffen der Recherche-Aufwand wird Euch überrollen!
So gewarnt habe ich weiter gelesen, als ein Kommissar aus Berlin als Ratgeber nach Darmstadt kommt (Münchow kommentiert das in den Anmerkungen als möglich, weil es ja verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Preußen und Hessen-Darmstadt gab), auch, dass die Darmstädter Polizei zu dumm war, einen Tatort nachts mit mehr als einer Kerze zu beleuchten und dass der Kommissar im höchsten Biedermeier einer ihm bis dahin völlig unbekannten Schauspielerin überraschend nahe kommt, ja sie mehrfach alleine in deren Wohnung besucht, habe ich beim Lesen als nicht unmöglich akzeptiert.
In Wikipedia habe ich mich dann darüber informiert, dass das Cello bis etwa 1850 ohne Stachel (so heißt der Spieß, auf dem das Instrument steht) wie die Gambe mit den Beinen gehalten wurde (bei Münchow spielt dieser offenbar ultramoderne Stachel eine wichtige Rolle…). Dass in Darmstädter Gasthäusern vor der schrecklichen Reblauskatastrophe (1874 erstmals in Deutschland..) harmlosen Ausländern Apfelwein angeboten wurde, ist allerdings kaum zu glauben. Stattdessen hätte der Autor zum Beispiel den von Goethe so geliebten Elfer unterbringen können, von dem sicher noch ein paar Flaschen in Darmstadt lagen. Einen Georg Büchner schließlich, der in der Bibliothek ausgerechnet einen preußischen Kommissar antimonarchisch agitiert, während dieser ihn später vor drohender Verfolgung warnt den will ich mir weder vorstellen noch über ihn lesen.
Ja, dieser Krimi aus der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in Darmstadt hat wunderbare Motive, Merck und Büchner Vater und Sohn sind großartige Figuren (und für einen neuen Versuch wüsste ich kaum, welche/r Büchner weniger als die/der andere ), das Niebergall´sche Lokalkolorit lässt durchaus (Theater-)Bilder vor dem inneren Augen erstehen, Glasharfe und Strychnin sind schöne, ordentlich recherchierte Details, die Großherzöge hatten wirklich unterschiedliche Ambitionen, was das Geld ausgeben anging, – aber riechen, schmecken, klingen tut die Welt dieses Krimis leider nicht.
Heiner Boehncke hat recht: schon ein einziger historischer Patzer kann den ganzen Spaß verderben, und leider ist es bei Münchow nicht bei einem geblieben…
Werner Münchow: Scharfes Glas. Ein Krimi mit Datterich.
Frankfurt. Societäts-Verlag. 2010. EAN 978-3797312303.
215 S. 14,80 €
